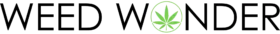Ein Jahr nach der teilweisen Freigabe von Cannabis in Bayern verzeichnen mehrere Kliniken im Freistaat einen Anstieg von psychotischen Erkrankungen. Doch ist dieser Trend tatsächlich auf die Gesetzesänderung zurückzuführen – oder liegen die Ursachen womöglich woanders?
Seit gut einem Jahr dürfen Erwachsene in Bayern geringe Mengen Cannabis besitzen und einige Pflanzen für den Eigenbedarf anbauen. Seither beobachtet beispielsweise das Bezirkskrankenhaus Augsburg eine Zunahme von Patienten mit psychotischen Symptomen nach Cannabiskonsum. Auch zwei weitere Einrichtungen – die Bezirksklinik Mittelfranken sowie das Bezirkskrankenhaus Lohr am Main – berichten von einem leichten Anstieg solcher Fälle mit mutmaßlich drogenbedingtem Hintergrund.
Steckt hinter dieser Entwicklung eine direkte Folge der Cannabis-Teillegalisierung? Haben mehr Menschen angefangen zu konsumieren, weil das Strafrisiko gesunken ist – und führt das vermehrt zu Psychosen?
Vom Schulvorbild zum Patienten mit Schizophrenie
Ein drastisches Beispiel für mögliche Auswirkungen des Cannabiskonsums liefert die Geschichte von Max (Name geändert). Mit 16 begann er, regelmäßig zu kiffen – obwohl er bis dahin als sportlicher, beliebter Einser-Schüler galt. Doch schon nach einigen Monaten zeigten sich erste psychotische Symptome. Statt aufzuhören, intensivierte er seinen Konsum.
Was folgte, war ein sozialer und gesundheitlicher Abstieg: Schulabbruch, Obdachlosigkeit, Haft. Heute lebt Max in einer betreuten Einrichtung und leidet an paranoider Schizophrenie. Seine behandelnden Ärzte führen die Erkrankung auf den langjährigen, intensiven Cannabiskonsum zurück. Er berichtet von Sinnesüberreizung und Halluzinationen – Stimmen hören, Dinge sehen, die nicht existieren. Zwar erhält er regelmäßig Medikamente, doch heilbar ist die Krankheit nicht.
THC-Gehalt als Risikofaktor
Prof. Dr. Oliver Pogarell, Psychiater und Leiter der klinischen Neurophysiologie an der LMU München, erklärt: Cannabis kann psychotische Episoden auslösen, insbesondere bei genetisch vorbelasteten Personen. Wer bereits familiäre Vorbelastungen im Bereich psychischer Erkrankungen hat, trägt ein erhöhtes Risiko.
Zudem spielt der Wirkstoffgehalt eine zentrale Rolle. Je höher der THC-Gehalt in der konsumierten Substanz, desto größer die Wahrscheinlichkeit psychischer Nebenwirkungen. Allerdings betrifft das nur einen kleineren Teil der Konsumierenden – viele bleiben ohne gesundheitliche Folgen.
Fehlende Belege für einen direkten Zusammenhang
Bislang gibt es keine wissenschaftlich fundierten Studien, die einen kausalen Zusammenhang zwischen Cannabislegalisierung und einem Anstieg psychischer Erkrankungen nachweisen. Auch eine Studie der University of Ottawa, veröffentlicht im Februar, konnte keine klare Verbindung feststellen.
Pogarell betont, dass der beobachtete Anstieg in Kliniken auch auf andere Faktoren zurückzuführen sein könnte. So werde inzwischen bei der Diagnose häufiger und gezielter nach dem Cannabiskonsum gefragt – das war früher nicht immer der Fall. Zudem greifen Jugendliche heute häufiger zu Cannabisprodukten, wodurch auch die Wahrscheinlichkeit steigt, entsprechende Fälle in der Klinik zu sehen. Ein flächendeckender Anstieg von Psychosen lasse sich aus seiner Sicht jedoch nicht ableiten.
Mehr Konsum – weniger Kriminalität
Laut der Kriminalstatistik 2024 ist die Zahl der Drogendelikte in Bayern nach der Teillegalisierung deutlich gesunken – um rund 39 Prozent. Gleichzeitig legen Erhebungen nahe, dass der Cannabiskonsum unter der Bevölkerung zugenommen hat.
Für junge Menschen ist der Konsum besonders riskant, so Pogarell. Da sich ihr Gehirn noch in der Entwicklung befindet, kann starker Konsum von THC-reichem Cannabis nachhaltige Schäden verursachen. Ob jemand besonders anfällig für psychische Erkrankungen ist, lässt sich im Vorfeld kaum einschätzen. Meist zeigt sich eine solche Verwundbarkeit (Vulnerabilität) erst dann, wenn entsprechende Symptome auftreten – und manchmal auch bleiben.